Elektra ist Oresteia
Inspiriert von der Sprachgewalt des Elektra-Dramas von Hugo von Hofmannsthal schuf Richard Strauss ein aufwühlendes Psychogramm der von Trauer, Schmerz und Wut getriebenen Elektra, die mithilfe ihres Bruders Orest die Rache an Mutter und Stiefvater vollzieht. Die belgische Regisseurin Lisaboa Houbrechts forschte auf einer mythologischen Reise nach Spuren.
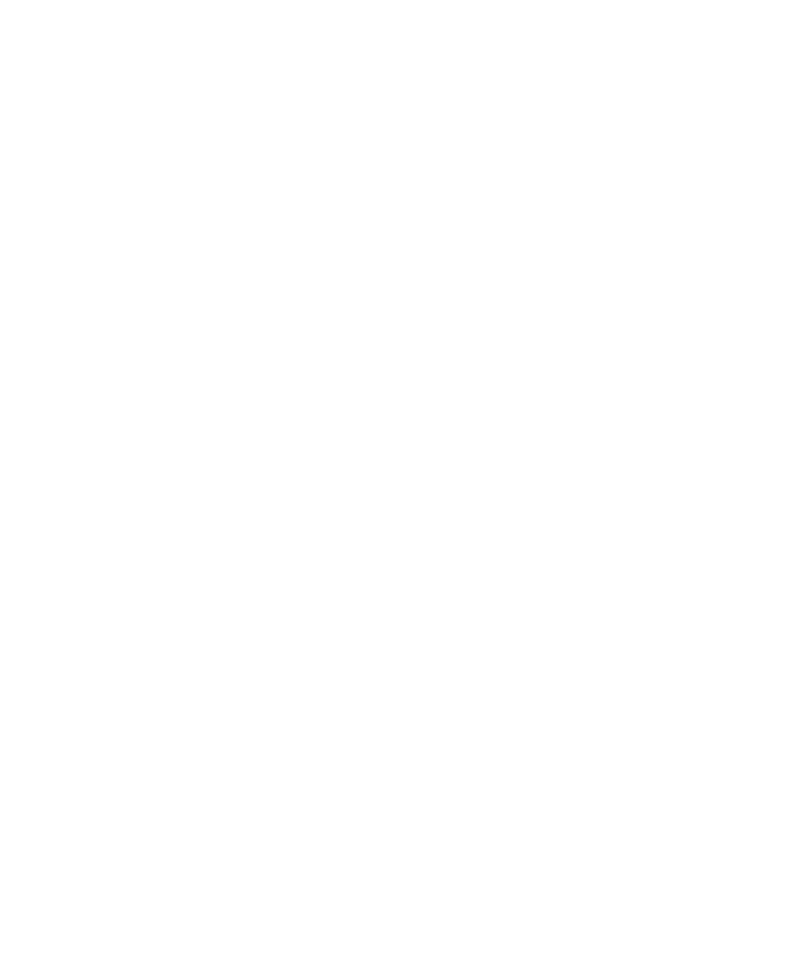
Lisaboa Houbrechts
Barbara Tacchini: Du hast dich auf deine Inszenierung von Strauss’ Oper Elektra unter anderem mit einer Reise nach Griechenland vorbereitet?
Lisaboa Houbrechts: Griechenland hat schon immer einen ganz besonderen Platz in meinem Leben und in meinem Herzen eingenommen, wegen all der Mythen und all den grossen Tragödien etwa von Aeschylos, Euripides and Sophokles. Ich reise oft dorthin, um mich inspirieren zu lassen. Das letzte Mal war ich dort, bevor ich Medea von Euripides für die Comédie-Française in Paris inszenierte. Da besuchte ich Korinth, wo die Argonautensage um Jason spielt. Diesmal wollte ich mehr über Elektra erfahren.
Barbara Tacchini: Du bist also nach Mykene gereist, zu den Ruinen des sagenumwobenen Palasts, in dem Agamemnon mit seiner Familie gelebt haben soll, bevor er in den Trojanischen Krieg zog, und wo er von seiner Frau Klytämnestra und deren Liebhaber Ägisth bei der Rückkehr perfide ermordet wurde?
Lisaboa Houbrechts: Ja genau, an den Ort, wo Elektra ihre ganze Jugend lang um ihren Vater leidet und sich nach Rache verzehrt. Und wo Orest und Elektra schliesslich ihre Mutter umbringen, wo also die ganze Geschichte spielt. Ich bin zu diesen Ruinen hinaufgewandert, die in einer bergigen Landschaft liegen, bin in die mythologische Landschaft eingetaucht, auf meinen Ohren Kopfhörer mit der Musik von Strauss. Es ist eine Art Romantik, die Steine zu berühren und mir vorzustellen, was da seit Jahrhunderten liegt. Aber auch einfach dort zu stehen, die Luft zu atmen und über diese Skyline von brüchigen Mauern und Bergen zu schauen, lässt mich anders über einige Passagen nachdenken, wie sie in der Oper geschrieben sind. Es lässt mich darüber nachdenken, wie Hofmannsthal den Elektra-Mythos neu adaptiert und ihn auf eine Art so menschlich gemacht hat.
Barbara Tacchini: Das klingt fast nach einer Kunstpilgerfahrt?
Lisaboa Houbrechts: Ich möchte diese Geschichte in die eigenen Füsse bekommen. Während ich durch den Palast gehe, die Grundrisse studiere, Korridore, Höfe, das Löwentor, die realen Entfernungen zurücklege, geht etwas von der Geschichte in meinen Körper über, und ich kann es dann anders auf die Bühne bringen. Wenn ich dorthin fahre, nehme ich jeweils ein sehr kleines Hotelzimmer, nichts Luxuriöses, ich esse bewusst wenig, damit ich mich intensiv auf meine Vorstellungskraft und meine Träume konzentrieren kann.
Barbara Tacchini: Du füllst also direkt vor Ort Notizbücher und Kopf mit Gedanken und Bildern?
Lisaboa Houbrechts: Interessanterweise kommt die Inspiration nie auf dem Höhepunkt des Augenblicks. Sie kommt, wenn ich mit dem Bus zurück nach Athen fahre, vorbei an verloren wirkenden Busbahnhöfen vielleicht, oder wenn ich mitten in der lärmigen Grossstadt stehe. Da begreife ich erst, was ich erlebt habe, und da kommt meine Fantasie ins Spiel. Oft sind es Fragmente von Bildern, Ideen zu Übergängen von einer Szene zur anderen. Zum Beispiel kam mir da die Idee des grossen Spiegels, den es im Bühnenbild geben wird. Das mag damit zu tun haben, dass ich das Meer wie einen Spiegel des Himmels sah. Das Meer wurde zum Himmel und der Himmel zum Meer, und der Palast auf dem Hügel zum schwebenden Schloss, wie in einem Traum. Dann hatte ich eine Idee zur Schlussszene mit dem Chor, der nicht wie von Strauss eigentlich vorgesehen im Off gesungen werden soll, sondern – wie aus einem Meer – hinter Elektra und Orest auftauchen soll. Wenn ich dann später vor den Sänger:innen stehe, kann ich ihnen mit dieser Erfahrung vielleicht auch ein Gefühl viel bildhafter beschreiben, wie eine Art Landschaft, die sie in ihre Motivationen einfliessen lassen können. Manchmal finde ich auch etwas, das ich später wie ein Geheimnis in eine Aufführung einbaue. Es gab einen besonderen Ort im Innern des Palasts, eine Art Keller mit einem kleinen Fenster, durch das man nach oben schauen und einen Baum sehen konnte. Ich habe meine Hand auf den Stein gelegt und mir vorgestellt, dass die Sängerin der Elektra das in einem bestimmten Moment macht, und ich kann ihr sagen «stell dir vor, du siehst einen Baum».
Lisaboa Houbrechts: Griechenland hat schon immer einen ganz besonderen Platz in meinem Leben und in meinem Herzen eingenommen, wegen all der Mythen und all den grossen Tragödien etwa von Aeschylos, Euripides and Sophokles. Ich reise oft dorthin, um mich inspirieren zu lassen. Das letzte Mal war ich dort, bevor ich Medea von Euripides für die Comédie-Française in Paris inszenierte. Da besuchte ich Korinth, wo die Argonautensage um Jason spielt. Diesmal wollte ich mehr über Elektra erfahren.
Barbara Tacchini: Du bist also nach Mykene gereist, zu den Ruinen des sagenumwobenen Palasts, in dem Agamemnon mit seiner Familie gelebt haben soll, bevor er in den Trojanischen Krieg zog, und wo er von seiner Frau Klytämnestra und deren Liebhaber Ägisth bei der Rückkehr perfide ermordet wurde?
Lisaboa Houbrechts: Ja genau, an den Ort, wo Elektra ihre ganze Jugend lang um ihren Vater leidet und sich nach Rache verzehrt. Und wo Orest und Elektra schliesslich ihre Mutter umbringen, wo also die ganze Geschichte spielt. Ich bin zu diesen Ruinen hinaufgewandert, die in einer bergigen Landschaft liegen, bin in die mythologische Landschaft eingetaucht, auf meinen Ohren Kopfhörer mit der Musik von Strauss. Es ist eine Art Romantik, die Steine zu berühren und mir vorzustellen, was da seit Jahrhunderten liegt. Aber auch einfach dort zu stehen, die Luft zu atmen und über diese Skyline von brüchigen Mauern und Bergen zu schauen, lässt mich anders über einige Passagen nachdenken, wie sie in der Oper geschrieben sind. Es lässt mich darüber nachdenken, wie Hofmannsthal den Elektra-Mythos neu adaptiert und ihn auf eine Art so menschlich gemacht hat.
Barbara Tacchini: Das klingt fast nach einer Kunstpilgerfahrt?
Lisaboa Houbrechts: Ich möchte diese Geschichte in die eigenen Füsse bekommen. Während ich durch den Palast gehe, die Grundrisse studiere, Korridore, Höfe, das Löwentor, die realen Entfernungen zurücklege, geht etwas von der Geschichte in meinen Körper über, und ich kann es dann anders auf die Bühne bringen. Wenn ich dorthin fahre, nehme ich jeweils ein sehr kleines Hotelzimmer, nichts Luxuriöses, ich esse bewusst wenig, damit ich mich intensiv auf meine Vorstellungskraft und meine Träume konzentrieren kann.
Barbara Tacchini: Du füllst also direkt vor Ort Notizbücher und Kopf mit Gedanken und Bildern?
Lisaboa Houbrechts: Interessanterweise kommt die Inspiration nie auf dem Höhepunkt des Augenblicks. Sie kommt, wenn ich mit dem Bus zurück nach Athen fahre, vorbei an verloren wirkenden Busbahnhöfen vielleicht, oder wenn ich mitten in der lärmigen Grossstadt stehe. Da begreife ich erst, was ich erlebt habe, und da kommt meine Fantasie ins Spiel. Oft sind es Fragmente von Bildern, Ideen zu Übergängen von einer Szene zur anderen. Zum Beispiel kam mir da die Idee des grossen Spiegels, den es im Bühnenbild geben wird. Das mag damit zu tun haben, dass ich das Meer wie einen Spiegel des Himmels sah. Das Meer wurde zum Himmel und der Himmel zum Meer, und der Palast auf dem Hügel zum schwebenden Schloss, wie in einem Traum. Dann hatte ich eine Idee zur Schlussszene mit dem Chor, der nicht wie von Strauss eigentlich vorgesehen im Off gesungen werden soll, sondern – wie aus einem Meer – hinter Elektra und Orest auftauchen soll. Wenn ich dann später vor den Sänger:innen stehe, kann ich ihnen mit dieser Erfahrung vielleicht auch ein Gefühl viel bildhafter beschreiben, wie eine Art Landschaft, die sie in ihre Motivationen einfliessen lassen können. Manchmal finde ich auch etwas, das ich später wie ein Geheimnis in eine Aufführung einbaue. Es gab einen besonderen Ort im Innern des Palasts, eine Art Keller mit einem kleinen Fenster, durch das man nach oben schauen und einen Baum sehen konnte. Ich habe meine Hand auf den Stein gelegt und mir vorgestellt, dass die Sängerin der Elektra das in einem bestimmten Moment macht, und ich kann ihr sagen «stell dir vor, du siehst einen Baum».
Barbara Tacchini: Mit deinem Kreativteam, der Bühnenbildnerin Clémence Bezat und dem Kostümbildner Oumar Dicko, arbeitest du sehr engzusammen. Das Bühnenbild von Clémence stellt zunächst ein Kinderzimmer dar mit Möbeln, die eine absichtlich grosse Dimension haben. Was hat euch zu dieser Entscheidung bewogen?
Lisaboa Houbrechts: Mein Team und mich verbindet die Idee, poetische Bilder zu schaffen, welche eine Aussage haben, ohne dass wir versuchen,die Geschichte wörtlich zu illustrieren. Wenn ich nach Griechenland reise, ist es für mich wie eine Reise in meine Kindheit, weil all dieseGeschichten wie die von Elektra, von Medea oder von Antigone: Das sind Geschichten, die mir als Kind in der Schule erzählt wurden. Als ich dann in der Highschool war, mit 15 Jahren, studierte ich Theater und Schauspiel und beschäftigte mich intensiver damit, konnte die Faszination aber nicht mit vielen Menschen teilen. In Griechenland aber spüre ich, dass die alten Mythen das Zentrum der Kultur bilden. Aus diesem Gefühl heraus wuchs die Idee, das Stück im Zimmer eines jungen Mädchens zu spielen, dessen Boden irgendwann aufbricht und aus dem – wie Ruinen von Säulen – grosse, phallusartige Strukturen aufsteigen, sodass wir uns plötzlich mitten in einer archaisch anmutenden Landschaft befinden.
Barbara Tacchini: Die Phalli stehen für Elektras allumfassende Faszination für ihren toten Vater?
Lisaboa Houbrechts: Elektra ruft andauernd nach einer männlichen Figur, zuerst nach Agamemnon, dann nach Orest. Interessant ist ja, dass im Palast von Mykene überall «Agamemnon» draufsteht, seine goldene Maske kann man im Museum bewundern, aber von Elektra findet man nichts. In diesem wie so oft einseitig männlichen Erbe nach dieser Frau zu suchen, das treibt mich an, zu zeigen, wie Elektra ihre eigene Identität aufspürt. Ich fand es irritierend, dass Elektra Orest braucht, um ihre Mutter zu töten, während ihre Mutter Klytämnestra ihren Mann Agamemnon selbst töten konnte. Politisch bildet dies im antiken Mythos aber nachvollziehbar den historischen Wechsel der politischen Macht ab. Die Geburt der Demokratie hat dazu geführt, dass die Frauen Rechte einbüssen. Diese Frau der jüngeren Generation braucht eine männliche Macht, um die Herrschaft zu stürzen. Das hat für mich viel mit heute zu tun. Wir leben in Zeiten, in denen die Dinge auch für jüngere Menschen oder jüngere Frauen manchmal ziemlich kompliziert sind, es gibt einen Konflikt zwischen den Generationen von Frauen. Das liess mich darüber nachdenken, welche Antwort ich mit meiner Interpretation der Oper Elektra darauf geben kann.
Barbara Tacchini: Elektra hat dafür gesorgt, dass der jüngere Bruder Orest dem Einfluss des Stiefvaters entzogen wurde und auf dem Land aufwuchs. Jetzt sehnt sie sich unendlich nach seiner Rückkehr als Rächer des Vaters.
Lisaboa Houbrechts: Der abwesende Orest repräsentiert die politische Passivität von Elektra. Das ganze Stück handelt ja davon, dass Vaterschaft und politische Macht irgendwie ausserhalb des Körpers liegen. Ich will erzählen, wie Elektra eine männliche Kraft in sich selbst findet. Am Anfang haben der Kostümbildner Oumar Dicko und ich mit dem Gedanken gespielt, Orest unsichtbar zu machen und zu zeigen, wie Elektra selbst die Mutter und den Stiefvater tötet. Aber dann wollten wir diesem Orest doch ein Gesicht geben. Wenn der Chor zum Schluss den Namen «Orest» singt, wieder und wieder, dann sehe ich etwas sehr Körperliches zwischen Elektra und Orest. Orest ist wie ein schwarzer Schatten, Elektra verwandelt sich von Schwarz zu Weiss, sie umtanzen einander, ihre Verbindung ist wie das Yin und Yang, eine spirituelle Verbindung zwischen dem Weiblichen und Männlichen: Orest ist Elektra, Elektra ist Orest. Wir hatten diese Idee für die Szene und die Kostüme, und ich habe sie dann in der Musik von Strauss wiedergefunden. Ich denke, das ist ein Zeichen dafür, dass es das Richtige ist.
Lisaboa Houbrechts: Mein Team und mich verbindet die Idee, poetische Bilder zu schaffen, welche eine Aussage haben, ohne dass wir versuchen,die Geschichte wörtlich zu illustrieren. Wenn ich nach Griechenland reise, ist es für mich wie eine Reise in meine Kindheit, weil all dieseGeschichten wie die von Elektra, von Medea oder von Antigone: Das sind Geschichten, die mir als Kind in der Schule erzählt wurden. Als ich dann in der Highschool war, mit 15 Jahren, studierte ich Theater und Schauspiel und beschäftigte mich intensiver damit, konnte die Faszination aber nicht mit vielen Menschen teilen. In Griechenland aber spüre ich, dass die alten Mythen das Zentrum der Kultur bilden. Aus diesem Gefühl heraus wuchs die Idee, das Stück im Zimmer eines jungen Mädchens zu spielen, dessen Boden irgendwann aufbricht und aus dem – wie Ruinen von Säulen – grosse, phallusartige Strukturen aufsteigen, sodass wir uns plötzlich mitten in einer archaisch anmutenden Landschaft befinden.
Barbara Tacchini: Die Phalli stehen für Elektras allumfassende Faszination für ihren toten Vater?
Lisaboa Houbrechts: Elektra ruft andauernd nach einer männlichen Figur, zuerst nach Agamemnon, dann nach Orest. Interessant ist ja, dass im Palast von Mykene überall «Agamemnon» draufsteht, seine goldene Maske kann man im Museum bewundern, aber von Elektra findet man nichts. In diesem wie so oft einseitig männlichen Erbe nach dieser Frau zu suchen, das treibt mich an, zu zeigen, wie Elektra ihre eigene Identität aufspürt. Ich fand es irritierend, dass Elektra Orest braucht, um ihre Mutter zu töten, während ihre Mutter Klytämnestra ihren Mann Agamemnon selbst töten konnte. Politisch bildet dies im antiken Mythos aber nachvollziehbar den historischen Wechsel der politischen Macht ab. Die Geburt der Demokratie hat dazu geführt, dass die Frauen Rechte einbüssen. Diese Frau der jüngeren Generation braucht eine männliche Macht, um die Herrschaft zu stürzen. Das hat für mich viel mit heute zu tun. Wir leben in Zeiten, in denen die Dinge auch für jüngere Menschen oder jüngere Frauen manchmal ziemlich kompliziert sind, es gibt einen Konflikt zwischen den Generationen von Frauen. Das liess mich darüber nachdenken, welche Antwort ich mit meiner Interpretation der Oper Elektra darauf geben kann.
Barbara Tacchini: Elektra hat dafür gesorgt, dass der jüngere Bruder Orest dem Einfluss des Stiefvaters entzogen wurde und auf dem Land aufwuchs. Jetzt sehnt sie sich unendlich nach seiner Rückkehr als Rächer des Vaters.
Lisaboa Houbrechts: Der abwesende Orest repräsentiert die politische Passivität von Elektra. Das ganze Stück handelt ja davon, dass Vaterschaft und politische Macht irgendwie ausserhalb des Körpers liegen. Ich will erzählen, wie Elektra eine männliche Kraft in sich selbst findet. Am Anfang haben der Kostümbildner Oumar Dicko und ich mit dem Gedanken gespielt, Orest unsichtbar zu machen und zu zeigen, wie Elektra selbst die Mutter und den Stiefvater tötet. Aber dann wollten wir diesem Orest doch ein Gesicht geben. Wenn der Chor zum Schluss den Namen «Orest» singt, wieder und wieder, dann sehe ich etwas sehr Körperliches zwischen Elektra und Orest. Orest ist wie ein schwarzer Schatten, Elektra verwandelt sich von Schwarz zu Weiss, sie umtanzen einander, ihre Verbindung ist wie das Yin und Yang, eine spirituelle Verbindung zwischen dem Weiblichen und Männlichen: Orest ist Elektra, Elektra ist Orest. Wir hatten diese Idee für die Szene und die Kostüme, und ich habe sie dann in der Musik von Strauss wiedergefunden. Ich denke, das ist ein Zeichen dafür, dass es das Richtige ist.
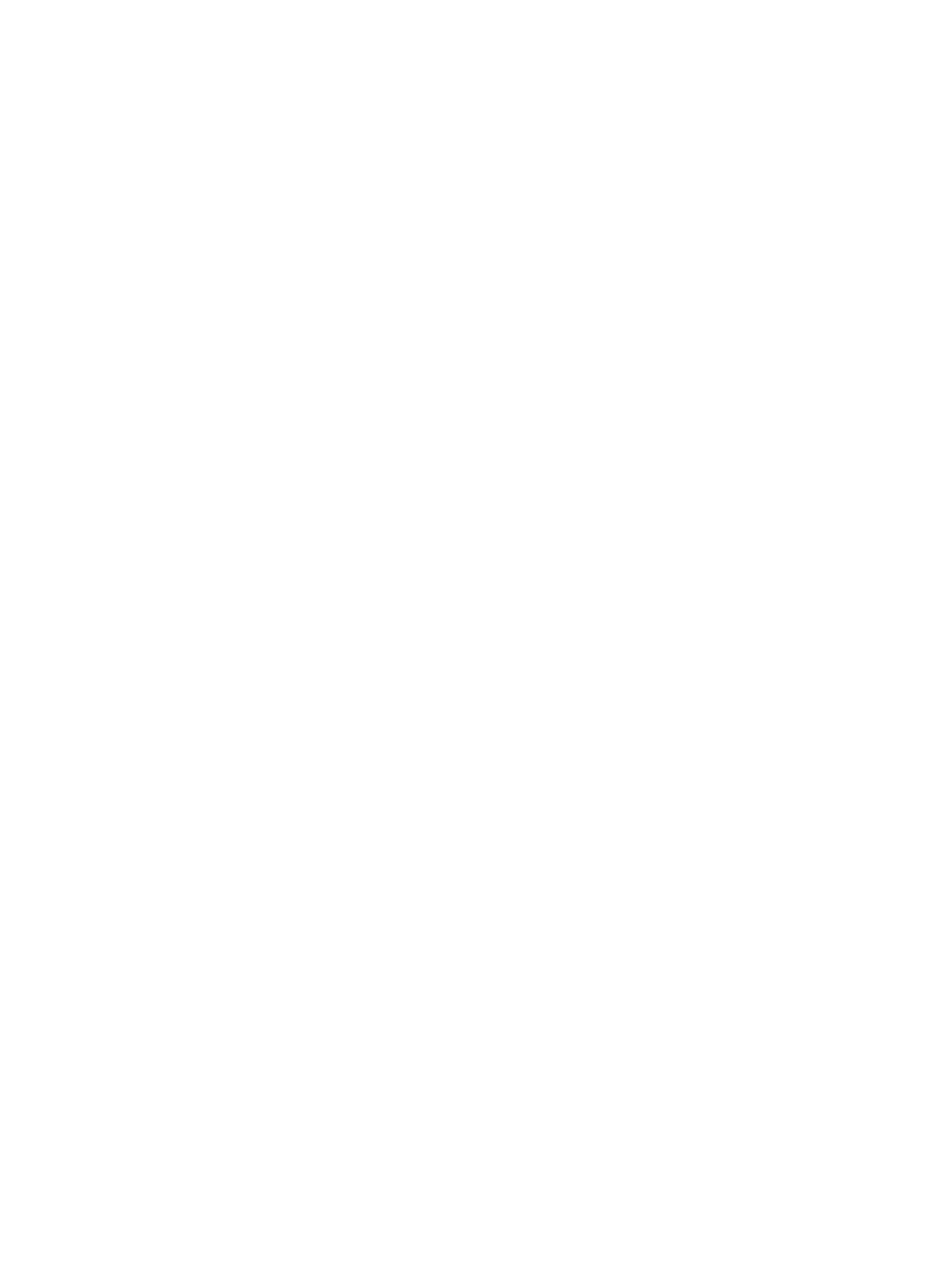
Lisaboa Houbrechts in den Ruinen von Mykene